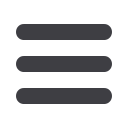
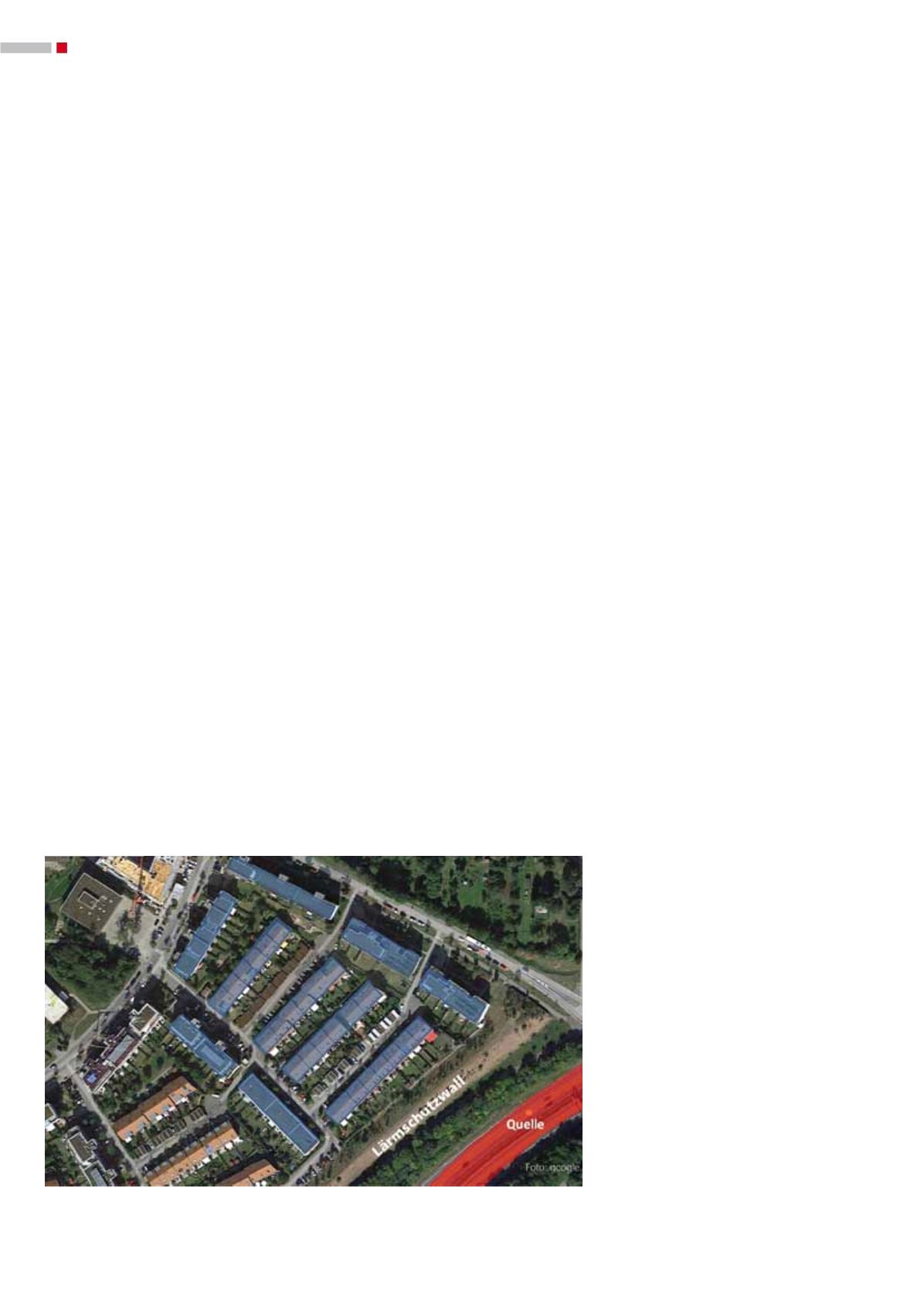
TECHNIK
|
Fachbeitrag
24
FASSADE 5/2016
Die zwei Gesichter der Akustik von
Fassaden
Von Prof. Dr.-Ing. Philip Leistner
Der innere Wert
An erster Stelle steht hier die Schalldäm-
mung von außen nach innen, gelegent-
lich auch umgekehrt. Erfahrungsgemäß
sind heute die Flächenbauteile problemlos
in der Lage, auch hohe Schalldämmwerte
zu erreichen. Als nach wie vor kritisch in
puncto Schallschutzwirkung erweisen sich
alle Arten von Fugen, Anschlüssen und
Durchdringungen, z. B. Lüftungsöffnun-
gen. Während der Schutz gegen Außenge-
räusche maßgeblich vom Standort des Ge-
bäudes und dessen Orientierung bestimmt
wird, gilt diese Abhängigkeit für die Schall-
Längsdämmung zwischen benachbarten
Räumen im Gebäude nicht. Die Fassade
als flankierendes Bauteil, ob in horizon-
taler oder vertikaler Richtung, entschei-
det in vielen Fällen über den resultieren-
Die akustische Funktionalität von Fassaden wird bislang meist in einer Richtung betrachtet: von
außen nach innen. Die umgekehrte Blickrichtung, also die Funktionalisierung und Wirkung
von Fassaden auf den urbanen Raum ist derzeit noch ungewohnt, obwohl Parallelen und
Synergieeffekte durch den Einklang der Merkmale offenkundig bestehen. Das Potenzial von
Fassaden, akustisch nicht nur als Barriere zwischen urbanem und innerem Raum, sondern als ein
Steuerungs- und Gestaltungselement für beide Seiten zu fungieren, ist jedenfalls beachtlich.
den Schallschutz zwischen den Räumen.
Ein zunehmend wichtiger Schallschutzas-
pekt ist die Geräuschentstehung von mo-
torisierten Lüftungs- und Verschattungs-
systemen und dergleichen. Dabei handelt
es sich meist nicht um ohrenbetäubenden
Lärm, die entstehenden Schallpegel sind
mitunter sogar akzeptabel und die Nutzer
schätzen ein hörbares Feedback. Die spek-
trale und zeitliche Charakteristik der Ge-
räusche ist jedoch für die Nutzer störend.
Neben diesen auf Ruhe hinter der Fassa-
de ausgerichteten Ansprüchen steht immer
wieder auch die akustische Anforderung
buchstäblich im Raum, dass die beträchtli-
che Fassadenfläche zur Innenraumakustik
beiträgt. Natürlich kann und soll die Fas-
sade das resultierende Defizit nicht allein
kompensieren, aber ein Beitrag wäre be-
reits hilfreich.
Akustik-Fassaden für den
urbanen Raum
Die Hörwahrnehmung von Fassaden im ur-
banen Kontext wird einerseits auf ihr Schall
reflektierendes Verhalten bezogen. Nicht
nur in ausgeprägten Straßenschluchten ver-
stärken die harten Gebäudeoberflächen al-
le Schallereignisse in unmittelbarer Nähe
der Quellen und tragen sie weit in das ur-
bane Umfeld. Natürlich wird auch die ab-
schirmende Wirkung von Gebäuden gern
zur Kenntnis genommen. Sie beeinflusst so-
wohl die Nachfrage als auch die Orientie-
rung von Raumnutzungen. Vor einer Erwei-
terung und Vertiefung dieser Überlegungen
ist jedoch die Frage zu beantworten, ob es
sich lohnt und ein Bedarf oder gar Bedürfnis
besteht. Warum sollten gerade die Fassaden
mehr und gezielt zur akustischen Stadtge-
staltung herangezogen werden? Aus ei-
ner Reihe möglicher Antworten sollen hier
zwei herausgegriffen werden. Erstens führt
die unverändert hohe Anziehungskraft der
Städte zu einer steigenden Beanspruchung
der urbanen Systeme und Strukturen. Nach
schwer zu revidierenden historischen Ent-
scheidungen in der Stadt- und Verkehrs-
planung sind heute die Folgen der demo-
graphischen Entwicklung, des unbändigen
Mobilitätsbedarfs und der aktuellen Trends
zur Nachverdichtung und Mischnutzung in
Städten zu spüren, und zwar auch deutlich
hörbar. Zweitens hat sich der allgegenwär-
tige urbane Lärm zu einem zentralen Faktor
der empfundenen und tatsächlichen Um-
welt- und Lebensqualität entwickelt. Na-
türlich kann die akustische Funktionalisie-
rung von Fassaden diese Probleme nicht
im Alleingang lösen. Aber auch hier gilt:
Jede Hilfe ist willkommen, wenn sie nach-
weislich und wirtschaftlich zur Verbesse-
rung der akustischen Gesamtbilanz beiträgt.
Abb. 1: Gebäudeensemble (blau markiert) in unmittelbarer Nähe zu einer Autobahn als
Lärmquelle (rot markiert) mit dazwischen liegendem, bewachsenem Lärmschutzwall.
Fraunhofer IBP (4)
















